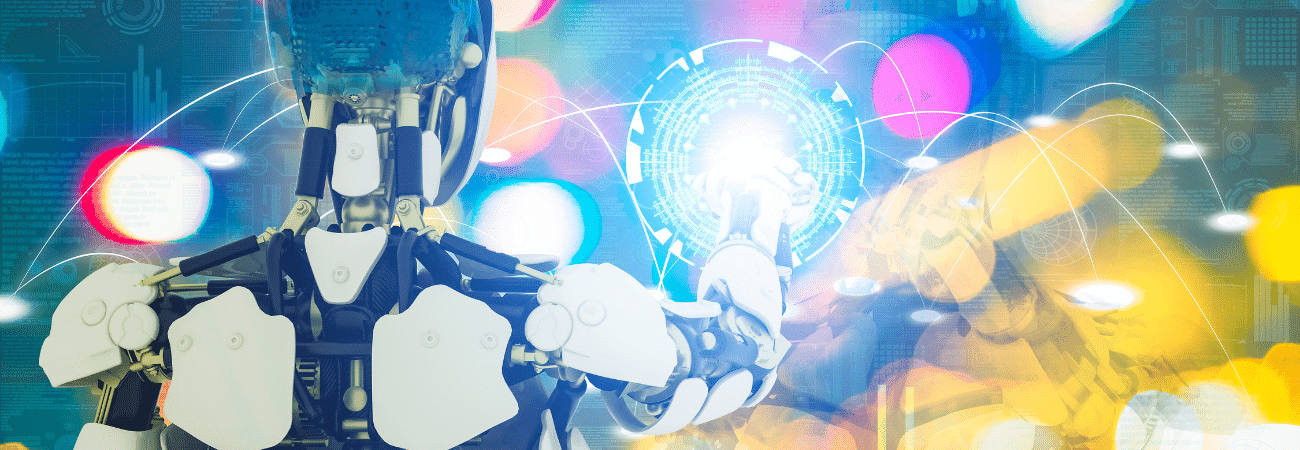
Der Kunstmarkt und der Einzug neuer Technologien – mehr Hoffnung als Realität
KI generierte Kunstwerke – Was steckt hinter dem Hype?
Im März 2025 stellte das Auktionshaus Christie’s erneut KI generierte Kunst ins Programm, der Gesamterlös dieser von regen Künstlerprotesten und öffentlichen Demonstrationen flankierten Online-Auktion lag jedoch nur bei 728.784 US-Dollar.
Alle zum Aufruf gebrachten Kunstwerke waren mit Hilfe von KI erschaffen worden. Aber: Die Versteigerung ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Lediglich ein Werk erzielte mehr als den Schätzpreis, 14 der insgesamt 34 zum Verkauf stehenden Stücke blieben jedoch ohne Gebote oder wurden unterhalb des geschätzten Mindestpreises verkauft. Kein positives Signal und kein Zeichen für eine starke Sammlernachfrage.
Die Marktlage wirkte noch vor Kurzem erheblich rosiger: Ende 2024 war bereits bei Sotheby’s das Porträtgemälde AI God (zu deutsch: KI Gott) der humanoiden Roboterkünstlerin Ai-Da für 1,2 Millionen Euro versteigert worden. Ein imposantes Ergebnis, denn das Werk war eigentlich nur zwischen 120.000 und 180.000 Euro eingewertet gewesen. Die gesetzte Taxe wurde damit verzehnfacht. Bereits das KI generierte Kunstwerk Edmond de Belamy war in 2018 von Christie’s weit über der Taxe von 7.000 – 10.000 Euro zugeschlagen worden — für insgesamt 380.000 Euro. Damals konnte der Schätzpreis um das 45-fache übertroffen werden.
Zukunftsprognose für KI-Kunst unsicher
Die weit über den Schätzpreisen liegenden Resultate erklären sich derzeit vor allem darüber, dass KI-Kunst bisher den Status einer Rarität hat, es ist der Reiz der Weltneuheit, der ihre Preise trieb. Es ist daher aktuell noch offen, inwieweit die Besitzer die Preise, die sie selbst auf den Auktionen gezahlt haben, im Weiterverkaufsfall erzielen können. Denn nur dann wäre der Ankauf für sie eine lohnenswerte Investition gewesen. Sollte jedoch der Kunstmarkt jetzt mehr und mehr von KI generierten Kunstwerken überschwemmt werden, wird ein renditestarkes Szenario immer unwahrscheinlicher.
Es handelt sich derzeit um ein Hype-Phänomen. Wie hoch die Nachfrage und die erzielbaren Umsätze für die KI-Kunst zukünftig ausfallen, kann aktuell noch nicht sicher prognostiziert werden. Zu verhaltener Vorsicht bei Investments in jene Werke wäre in jedem Falle zu raten.
NFTs als Sammelobjekte – Der Boom ist vorbei
Kryptokunst, auch NFT-Kunst genannt, bezeichnet digitale Kunstwerke, die als Non-Fungible Token (NFTs) auf einer Blockchain, einer dezentralen öffentlichen Datenbank, gespeichert werden. Ein NFT ist ein einzigartiges digitales Zertifikat, das die Echtheit und den Besitz eines digitalen Bild-Objekts rechtssicher nachweist. Das digitale Kunstwerk ist der dazu sichtbare Teil des NFT, der zu dem Programmcode der kryptographisch erstellten Datenreihe gehört. Hinterlegt ist dieser auf der Blockchain, jener Technologie, die eine transparente und manipulationssichere Dokumentation der Eigentümerdaten und Transaktionshistorie der digitalen Assets ermöglichen soll. Das digitale Bildobjekt wird in einer sog. digitalen Wallet aufbewahrt.
Nach einem Boom in den Jahren 2020 bis 2022 — als für einige dieser digitalen Sammelobjekte Preissteigerungen von bis zum 10.000 % möglich waren — ist der Hype inzwischen stark abgeflacht, aktuell gilt er als eingebrochen. Zeiten, in denen ein Krypto-Künstler wie Beeple ein NFT-Kunstwerk für die Rekordsumme von 69,3 Millionen US-Dollar bei Christie’s versteigern konnte, sind vorbei. Die Verkäufe von kunstbezogenen NFTs sanken vom Höchststand von 2,9 Milliarden USD im Jahr 2021 deutlich ab.
Der 2024 von Dapp veröffentliche Radar-Bericht legte offen, dass 95 % derjenigen, die NFT-Sammlungen besitzen, aktuell nur wertlose digitale Vermögenswerte halten. 98% der NFT-Bestände zeigten in 2024 überhaupt keinen Handel, was auf eine gänzlich weggebrochene Nachfrage hinweist. Geschätzt konnten lediglich 0,2 % der NFT-Drops überhaupt mit Gewinn für die Herausgeber stattfinden. Das bedeutet, dass alle übrigen NFT-Projekte Minusgeschäfte waren. Selbst von den NFTs, für die noch eine nennenswerte Nachfrage besteht, waren nur 11,9 % profitabel.
Das wohl berühmteste Beispiel für die massiven Wertverluste, die NFT-Investoren hinnehmen mussten, ist die gehypte Sammlung der Bored Apes. Sie war im Frühjahr 2021 mit 4 Milliarden US-Dollar bewertet worden, inzwischen haben auch die digitalen Affenbilder über 90% ihres ehemaligen Werts verloren.
Ob NFT-Kunst ein gutes Investment darstellt, hängt stark von den individuellen Zielen, der Duldsamkeit und der Risikobereitschaft des Investors ab. Aktuell ist der Markt für NFTs übersättigt, er ist überflutet mit digitalen Sammelobjekten, die in ästhetischer und künstlerischer Hinsicht von geringer Qualität sind. Die Wertentwicklung, die der Markt für NFT-Kunst gezeigt hat, könnte sich in Zukunft für KI generierte Kunstwerke wiederholen, sofern auch hier der Markt mit generischen Arbeiten minderer inhaltlicher Qualität überschwemmt wird, für die es weithin keine Nachfrage gibt.
Im direkten Vergleich zu NFTs zeigen traditionelle Kunstwerke hingegen eine durchweg positive Performance. Somit bleibt der Sachwert Kunst aufgrund seiner Wertstabilität, dank der gesicherten Nachfrage und der etablierten Marktstrukturen die weitaus bessere Wahl für Investoren als die neuen digitalen Sammelobjekte aus dem Bereich der NFTs.
Digital fraktionalisierte Kunstwerke
Sie heißen Masterworks, arttrade, finexity, Timeless oder Artemundi — die Offerte dieser Start-Ups ist die gleiche: Sie bieten Investoren den Erwerb von digital fraktionalisierten Anteilen an teuren Kunstwerken und hochwertigen Sammlerstücken (z.B. Oldtimer, Luxusuhren etc.) an. Investiert werden kann online und direkt per App. Ihr Versprechen: Die Demokratisierung von Passion Investments, denn das Modell der Blockchain basierten Fraktionalisierung ermöglicht es nun auch Investoren, die nur kleinere Summen aufbringen können oder wollen, in die wertvollen Sachwerte dieses Hochpreissektors zu investieren. Einige Anbieter halten sogar einen eigenen Zweitmarkt für die erworbenen Shares bereit, sodass die gehaltenen digitalen Anteile an den Sachwerten intern jederzeit weiterverkauft werden können.
Worauf wäre bei den Investitionen in Anteile von fraktionalisierten Kunstwerken zu achten? Bestehen hier besondere Risiken?
Prinzipiell müssen bei einem Investment in digitalisierte Anteile an einem wertvollen Kunstwerk die gleichen Prinzipien eingehalten werden wie bei dem Erwerb einer künstlerischen Arbeit über den traditionellen Kunsthandel: Qualität, Echtheit, Provenienz, ein guter Erhaltungszustand und eine eindrucksvolle Ausstellungshistorie sind immer wertbestimmend. Inbesondere der Einstiegspreis ist entscheiden, wenn später gewinnbringend wieder verkauft werden soll. Diese Faktoren bleiben daher auch bei Investments in fraktionalisierte Kunstwerke entscheidend.
Fraktionalisierte Anteilsmodelle haben den Vorteil, dass schon mit erheblich geringeren Investitionssummen in diese Assetklasse ein breiter Diversifikationsgrad erreicht werden kann.
Anbieter von fraktionalisierten Kunstwerken genau analysieren
Ein gewisses Risiko liegt tatsächlich eher auf der Anbieterseite dieser Investmentmöglichkeiten, handelt es sich doch immer um junge Tech-Unternehmen, die von Risikokapital abhängig sind. Bekanntermaßen scheitern 9 von 10 Start-Ups, was das Risiko einer Insolvenz erheblich erhöht. Aus diesem Grunde sollten vor den getätigten Investments in fraktionalisierte Kunstwerke immer auch die Anbieter kritisch geprüft werden. Was steht in den AGBs, was ist über die internen Verträge und juristischen Lösungen bekannt, wie im Insolvenzfall mit den gehaltenen Sachwerten verfahren wird. Wie gut sind die juristischen Lösungen, die diese Start-Ups für einen möglichen Insolvenzfall hinsichtlich der gehaltenen Sachwerte für ihre Kunden gefunden haben und wie transparent wird hinsichtlich dieses Problemkreises mit den Nutzern kommuniziert? Das sind Fragen, die die Risikoanalyse derartiger Investments massiv bestimmen.
Kostenstruktur und Risiken fraktionalisierter Kunstwerke
Bei fraktionalisierten Kunstinvestments sollten potenzielle Anleger die Kostenstruktur sorgfältig prüfen. In der Regel fallen bereits beim Erwerb Gebühren an, beispielsweise in Form von Ausgabeaufschlägen oder Servicekosten. Hinzu kommen laufende Kosten, etwa für Lagerung, Versicherung, Bewertung und Verwaltung des Kunstwerks. Einige Anbieter erheben zudem Verwaltungsgebühren oder Beteiligungen an einem späteren Verkaufserlös. Sollte das Kunstwerk mit Gewinn veräußert werden, ist daher zu beachten, dass hiervon unter Umständen ein nicht unerheblicher Teil an den Anbieter oder die Plattform fließt.
Im Falle eines Wertverlustes hingegen trägt der Investor das Risiko in voller Höhe – der Anteil kann im schlimmsten Fall vollständig wertlos werden.
V-CHECK Webinar mit Dr. Christopher Arendt und Markus van de Weye: Krypto-Gewinne mit Bitcoin, NFTs & Co erzielen und richtig versteuern | Webinar
Das Interesse an sogenannten Krypto-Assets steigt rasant – ebenso wie aktuell wieder die Kurse. Durch die beträchtlichen Wertsteigerungen in den letzten Monaten in Verbindung mit den vereinfachten Zugängen zum Markt, etwa durch Blackrock ETFs, eröffnen sich neue Perspektiven für die Geldanlage. Neben dem Handel mit Krypto-Coins bieten auch andere blockchainbasierte Geschäftsideen und erfolgreiche Projekte im NFT-Bereich spannende Investitionsmöglichkeiten.


