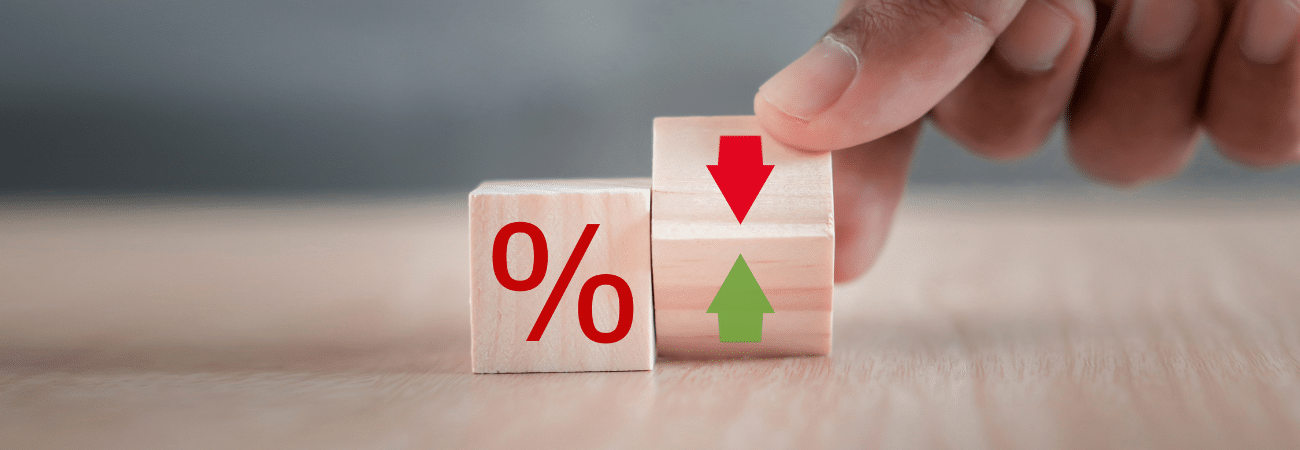
So wirken sich die Zinssenkungen der EZB auf verschiedene Anlageklassen aus
Auswirkungen auf Tagesgeld
Niedrigere Zinsen bedeuten in der Regel eine geringere Verzinsung auf Tagesgeld– und Festgeldkonten, da Banken ihre Sparzinsen an die Leitzinsen der EZB koppeln. Für Anleger, die ihr Kapital sicher und flexibel anlegen wollen, bedeutet dies eine sinkende Rendite. Zusätzlich verschärft die Inflation das Problem, da die realen Erträge oft negativ sind.
Ein einfaches Beispiel zeigt die Auswirkungen: Wer 50.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto mit 0,5 Prozent Zinsen jährlich anlegt, erhält 250 Euro an Zinserträgen. Bei einer Inflation von drei Prozent jährlich verliert das Geld jedoch real an Kaufkraft. Hinzu kommt die Kapitalertragssteuer von 26,375 Prozent inklusive Solidaritätszuschlag, sodass nach Steuern nur rund 184 Euro übrigbleiben. In einem Jahr beträgt der Kaufkraftverlust in unserem Beispiel 1.500 Euro. Renditen unterhalb dieser Marke bedeuten einen realen Kaufkraftverlust für Anleger. Das Vermögen bleibt in diesem Fall lediglich nominal erhalten.
Grafik: Kurzfristiger Geldmarktzins in Deutschland abzgl. der Inflationsrate und 26,375 % Kapitalertragssteuer inkl. Solidaritätszuschlag
In dieser Grafik wird deutlich: Wer nur auf Tages- oder Festgeldanlagen setzte, verlor in den letzten 10 Jahren kontinuierlich an realer Kaufkraft, hat jedoch sein Vermögen nominal erhalten.

Auswirkungen auf Anleihen
Zinssenkungen beeinflussen den Anleihemarkt auf unterschiedliche Weise. Bestehende Anleihen mit höheren Kupons gewinnen an Wert, da ihre Zinsen im Vergleich zu neu emittierten Anleihen attraktiver werden. Neue Anleihen hingegen werden mit niedrigeren Zinssätzen ausgegeben.
Allerdings ist für die Preisentwicklung von Anleihen mit längeren Laufzeiten nicht allein der von der EZB festgelegte kurzfristige Zins entscheidend. Der Marktzins für langfristige Anleihen setzt sich zusammen aus dem aktuellen Leitzins, einer Laufzeitprämie sowie den Inflations- Wachstumserwartungen an die Wirtschaft. Das bedeutet, dass eine Senkung des Leitzinses durch die EZB nicht zwangsläufig zu einem Rückgang der langfristigen Marktzinsen führen muss. Falls Investoren beispielsweise höhere Inflation oder stärkeres Wirtschaftswachstum erwarten, könnten die langfristigen Zinsen trotz einer EZB-Zinssenkung stabil bleiben oder sogar steigen. Dies ist im Grunde auch der Normalfall. Die Zinsstruktur (wenn sie normal aufgestellt ist) ist eher steil, heißt: je länger die Laufzeit, desto höher der Zins.
Diesen Fall können wir derzeit am Anleihemarkt beobachten. Die EZB senkte in den letzten Monaten den Leitzins von 4,25 auf 2,65 Prozent und dennoch stieg der langfristige Zins für Bundesanleihen, da die deutsche Regierung ein großes Investitionspaket plant, welches die Markteinschätzungen für Bonität, Wachstum und Inflation beeinflusst.
Privatanleger sollten sich der Chancen und Risiken bewusst sein. Anleihen mit längerer Laufzeit reagieren besonders sensibel auf Veränderungen der Marktzinsen, sodass Chance und Risiko mit Länge der Laufzeit zunehmen. Wer eine geringere Schwankung bevorzugt, sollte sich eher in Anleihen mit kurzer Restlaufzeit (zum Beispiel ein bis drei Jahre) positionieren. Dabei gilt es Risiko und Rendite klug abzuwägen.
Neue Anleihen mit geringer Restlaufzeit bieten oft nur noch geringere Erträge, sodass Anleger abwägen müssen, ob die verbleibende Rendite noch ausreicht, oder sie mehr Durationsrisiken eingehen möchten. Zudem entsteht bei kurzen Laufzeiten auch ein Wiederanlagerisiko, da in einem Trend sinkender Zinsen die Neu-/Wiederanlage nur zu schlechteren Zinskonditionen getätigt werden kann.
V-CHECK Video:
FED & EZB-Zinsen 2025: Welche Folgen hat die Geldpolitik der Notenbanken für Anleihenfonds?
Die großen Notenbanken sind mitten im Zinssenkungs-Zyklus – doch wie stark und wie schnell fallen die Zinsen? Und welche Unterschiede gibt es zwischen der Geldpolitik der EZB und der Fed? Antworten von Helge Müller, Gründer und Chief Investment Officer bei Genéve Invest, im Interview.
Auswirkungen auf Aktien
Unternehmen profitieren unterschiedlich von sinkenden Zinsen. Branchen, die stark auf Fremdfinanzierung angewiesen sind, können günstigere Kredite aufnehmen und dadurch wachsen. Einige Sektoren sind traditionell auf langfristige (Fremdkapital-) Finanzierungen angewiesen. Zu diesen gehören beispielsweise Immobilien- und Bauunternehmen, Industrie oder Öl- und Gasproduzenten.
All diese Sektoren haben lange Investitionszyklen in materielle Anlagegüter und müssen sich somit ihre Finanzierung mit einer langen Laufzeit sichern. Für diese Unternehmen wirken langfristig hohe Zinsen negativ, da sie nur zu schlechteren Konditionen an Fremdkapital kommen.


