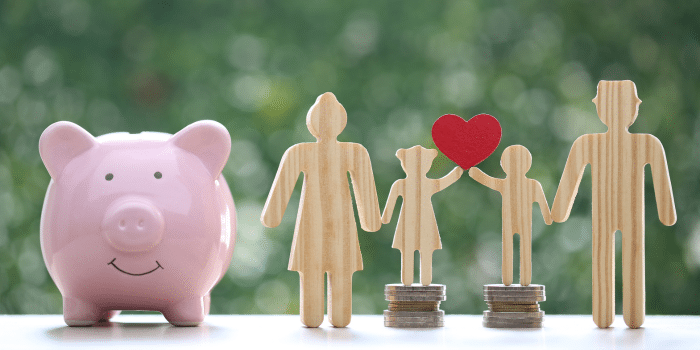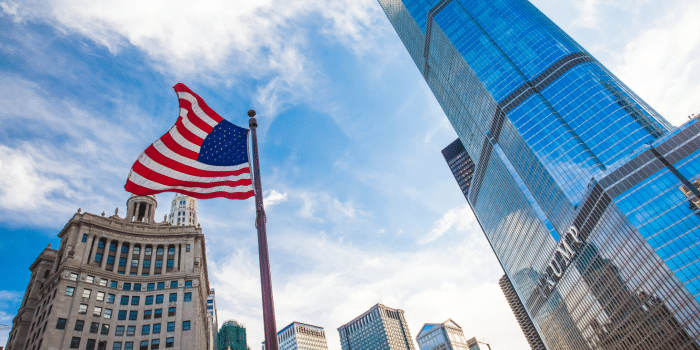Familienstiftung – alles, was Sie wissen müssen
um Ihr Vermögen zu schützen
- Stichwort Vermögensschutz: Viele Vermögende suchen rechtssichere Wege, um ihre Vermögenswerte vor allem mit Blick auf die Generationenfolge vor Zersplitterung zu bewahren und Streitigkeiten um Aktien, Immobilien und Co. zu vermeiden
- Eine Familienstiftung kann im Vermögensschutz stabile Rahmenbedingungen schaffen
- Familienstiftung ist eine juristische Person, die „sich selbst gehört“
- Familie des Stifters kann aus den Erträgen des Vermögens unterstützt werden
- Stiftungssatzung versammelt alle Details, die für die Asset Protection wichtig sind
- Erträge aus der laufenden Vermögensverwaltung werden niedriger besteuert
- Familienstiftung ist eine wichtige Säule im Vermögensschutz

Thorsten Klinkner, Rechtsanwalt und Steuerberater, geschäftsführender Gesellschafter der UnternehmerKompositionen GmbH und Experte für Familienstiftungen
Was versteht man unter Vermögensschutz?
Asset Protection, also umfassender rechtlicher, steuerlicher und strategischer Vermögensschutz, ist für viele Vermögende zu einem wesentlichen Schlagwort in ihrer Vermögensstrategie geworden. Asset Protection meint eine Strategie, um ein Vermögen – seien es Wertpapiere, Edelmetalle, Kunstwerke, Barvermögen und Immobilien oder auch unternehmerische Beteiligungen – so zu strukturieren, dass es vor schädlichen Einflüssen bestmöglich geschützt ist. Das können ungünstige steuerliche Wirkungen sein, Streitigkeiten und Pflichtteilsansprüche in der Erbengeneration, Abfindungen bei Scheidung oder auch Durchgriffe ins Privatvermögen in bestimmten Haftungssituationen.
Kapital- und Personengesellschaften sowie Privatvermögen bieten keinen ausreichenden Vermögensschutz
Das Problem: Weder das Halten der Assets im Privatvermögen noch die typischen Kapital- und Personengesellschaftsformen bieten ausreichende Möglichkeiten, um eine echte Brandmauer ums Vermögen zu errichten. Daher hat sich in den vergangenen Jahren das Instrument der Familienstiftung profiliert, eine mit Vermögen ausgestattete Institution, die dauerhaft dem Interesse einer Familie dient. Die Familienstiftung als selbstständiges Rechtsinstitut übernimmt die Eigentümerrolle über ein Vermögen, sodass grundsätzlich keine Vermögenswerte aufgespalten werden. Die Stiftung ist eine juristische Person, die „sich selbst gehört“. Denn nach der Übertragung an die Familienstiftung ist das Vermögen Eigentum dieser und damit vollständig dem Privatvermögen des Stifters entzogen. Im Unterschied zu Personen- oder Kapitalgesellschaften hat sie also auch keine Anteile und keine Gesellschafter.
Die Errichtung einer Stiftung erfolgt in Deutschland immer im Einklang mit der jeweils gültigen Rechtsprechung. Die Stiftung muss von der Stiftungsaufsicht anerkannt werden. Sie beaufsichtigt Deutschlands Stiftungen und stellt die Rechtmäßigkeit von Stiftungsgründungen und der daraus resultierenden Stiftungsgeschäfte sicher. Sie ist der „Garant des Stifterwillens“. Denn der Stifter legt im Rahmen seines Stifterwillens die Leitlinien für den Umgang mit den Vermögen und die Ausschüttungsmodalitäten fest. Denn die Familie steht jederzeit im Fokus: Sie soll aus den Erträgen des Vermögens versorgt werden, seien es Zinsen, Dividenden, Mieten oder Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und anderen Assets. Die Familienstiftung kann Kosten übernehmen (Schul- und Ausbildungskosten der Kinder und nachfolgender Generationen), sie kann Zuwendungen an Begünstigte zahlen oder Mitglieder der Stifterfamilie (als Vorstände oder in anderen Funktionen) vergüten.
Die Errichtung einer Stiftung erfolgt in Deutschland immer im Einklang mit der jeweils gültigen Rechtsprechung. Die Stiftung muss von der Stiftungsaufsicht anerkannt werden. Sie beaufsichtigt Deutschlands Stiftungen und stellt die Rechtmäßigkeit von Stiftungsgründungen und der daraus resultierenden Stiftungsgeschäfte sicher. Sie ist der „Garant des Stifterwillens“. Denn der Stifter legt im Rahmen seines Stifterwillens die Leitlinien für den Umgang mit den Vermögen und die Ausschüttungsmodalitäten fest. Denn die Familie steht jederzeit im Fokus: Sie soll aus den Erträgen des Vermögens versorgt werden, seien es Zinsen, Dividenden, Mieten oder Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und anderen Assets. Die Familienstiftung kann Kosten übernehmen (Schul- und Ausbildungskosten der Kinder und nachfolgender Generationen), sie kann Zuwendungen an Begünstigte zahlen oder Mitglieder der Stifterfamilie (als Vorstände oder in anderen Funktionen) vergüten.
Der Person des Stifters und der Familie kommt somit eine grundlegende Rolle bei der Gestaltung der Familienstiftung zu – eine viel gewichtigere als bei allen anderen bekannten Rechtsformen. Bei der Familienstiftung geht es immer um Klarheit und Stabilität. Die Familie des Stifterunternehmers ist ein entscheidender Aspekt in jeder Stiftungsstrategie. In der Stiftungssatzung finden sich alle Details wieder, die für die Asset Protection wichtig sind. Der Stifter formuliert darin seine Wünsche und Grundsätze und legt die Einbindung der Familie, das Management von Stiftung und Vermögen fest. Das führt zu mehr Klarheit bei allen Beteiligten und schafft einen Zugang zum verantwortlichen, zukunftsorientierten Umgang mit dem Familienvermögen.
Es ist keine andere Rechtsform bekannt, mittels derer sich ein Vermögen derart über die Generationen erhalten und rechtlich, steuerlich und strategisch schützen lässt wie mit der Familienstiftung. Die Familie profitiert durch klar definierte Ausschüttungsmodalitäten von den Vermögenswerten, während die Erträge aus der laufenden Vermögensverwaltung wesentlich niedriger besteuert werden als auf der privaten Ebene: Auf Erträge innerhalb der Vermögensverwaltung der Stiftung fallen 15 Prozent Körperschaftssteuer an, die Zuwendungen an die Begünstigten unterliegen der Kapitalertragssteuer, die mit 25 Prozent abgegolten werden (im Gegensatz zur persönlichen Einkommensbesteuerung, die bis zu 45 Prozent betragen kann). Die Stiftung ermöglicht durch ihre besondere Rechtsstellung eine steuerschonende Ertrags- und Ausschüttungspraxis, sodass das Vermögen durch das Prinzip der Familienstiftung erheblich gestärkt wird.
Auch mögliche schenkungs- und erbschaftsneuerliche Risiken werden durch die Errichtung einer Familienstiftung maßgeblich entschärft. Durch die Erbersatzsteuer werden die monetären Anforderungen an die Übertragung auf die nächste Generation in einer Stiftung zeitlich und betriebswirtschaftlich planbar. Diese wird alle 30 Jahre fällig, bei der Festsetzung greifen die steuerlichen Freibeträge für die beiden anzunehmenden Kinder, also jeweils 400.000 Euro. Dabei können Stiftungen den Zahlungsmodus frei wählen. Entweder sie zahlen den fälligen Betrag auf einmal, oder aber sie teilen ihn auf 30 gleiche, verzinste Jahresbeiträge auf.
Die Familienstiftung ist also eine wichtige Säule im Vermögensschutz und dazu geeignet, eine stabile Basis für die Sicherung und Entwicklung von aufgebauten Vermögenswerten zu bilden. Entscheidend ist eine individuelle Komposition. Denn auf der Grundlage eines ganzheitlichen Stiftungskonzeptes können Vermögensinhaber selbstbestimmt die Zukunft ihrer Nachkommen und Assets gestalten.
Die Familienstiftung
Die Stiftungsform dient in besonderem Maße der Familienförderung und ihrem Frieden, einer sinnvoll gestalteten Unternehmensweitergabe und -fortführung und dem Vermögensschutz. Die Familienstiftung als selbstständiges Rechtsinstitut übernimmt die Eigentümerrolle über ein Vermögen, sodass grundsätzlich keine Vermögenswerte veräußert werden können. Zugleich wird die Ausschüttungspraxis so geregelt, dass die Familie und andere Begünstigte von den Gewinnen aus der Vermögensverwaltung profitieren. Und zwar so, wie der Vermögenseigentümer es in der Stiftungssatzung definiert hat. Die Familienstiftung ist ein Instrument, um den angestrebten Erhalt über die Generationen hinaus zu ermöglichen. Die Familienstiftung steht also dafür, Vermögenswerte jeder Art hinter eine Brandmauer zu bringen, um größtmöglichen Schutz zu gewährleisten.
Auf was muss ein Stifter bei der Familienstiftung achten?
Die Errichtung der Familienstiftung ist nur der Schlusspunkt einer gelungenen Gesamtkomposition. Auch wenn es banal klingt: Es gilt, das Ziel des Vermögenssituation genau reflektieren und die Ausgangssituation sorgfältig betrachten. Dazu gehört die gesamte Klaviatur in der rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Gestaltung und Strukturierung, seien es Gesellschaftsverträge, Betriebsaufspaltungen, Testamente, Eheverträge und Familienchartas oder Beteiligungsmodelle, Investmentportfolios oder auch die Pläne zur generationsübergreifenden Führung des Familienunternehmens. Im Mittelpunkt steht, die Wünsche und Vorstellungen des Stifters hinsichtlich des Eigentums und der Familie zu erfahren und mit ihm gemeinsam ergebnisoffen seine Idee einer zukunftsorientierten Eigentümerstruktur zu erfahren.
Wie hilft die Familienstiftung bei der Erbschaftsteuer?
Bei Schenkungen und Erbschaften können Begünstigte Freibeträge in Anspruch nehmen. Ehegatten können alle zehn Jahre 500.000 Euro steuerfrei erhalten, Kinder 400.000 Euro. Bei größeren Vermögen sind diese Freibeträge aber schnell aufgebraucht, sodass es bei Übertragungen zu hohen steuerlichen Belastungen kommen kann. Die Erbersatzsteuer bei der Familienstiftung verhindert den Erbfall im Privatvermögen. Demnach wird für das Vermögen einer Familienstiftung alle 30 Jahre ein Erbfall simuliert, wodurch die Familienstiftung auf ihre Vermögenssubstanz Erbschaftsteuer zahlt. Durch die Erbersatzsteuer entsteht eine hohe finanzielle Planungssicherheit, zudem greifen bei der Festsetzung die steuerlichen Freibeträge für die beiden anzunehmenden Kinder. Die Erbersatzsteuer kann alle 30 Jahre auf einmal gezahlt oder verzinst auf 30 gleiche Jahresbeiträge aufgeteilt werden.
Welche Typen von Stiftungen gibt es?

Aufzeichnung Webinar: Damit Ihr Unternehmenswerk dauerhaft (fort)lebt: Einfach mal Stiften gehen!
Sie sind als Unternehmer erfolgreich und wollen, dass Ihr Lebenswerk dauerhaft Bestand hat. Dann ist die Gründung einer Stiftung ein guter Weg, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik nachhaltig zu verändern. Aktuell gibt es rund 24.000 rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland – und jedes Jahr kommen über 700 dazu. Wer eine Stiftung gründen will, hat viele Fragen: Welches Ziel habe ich und was ist die beste Stiftungsform dafür? Passt das eingesetzte Vermögen zum beabsichtigten Zweck und wie lege ich es an? Wie viel Arbeit möchte ich investieren und wie hoch sind die Verwaltungskosten? Auf diese und viele weitere Fragen geben die Experten Frank Wieser, Michael Thaler und Dr. Rolf Müller in diesem Webinar Antworten und Orientierung. Sie erklären:
- die ersten Schritte zu einer erfolgreichen Stiftungsgründung,
- mögliche Anlagestrategien für Ihr Stiftungen am Praxis-Beispiel der Werner Reichenberger Stiftung sowie
- das digitale betrieblichen Steuerreporting (BSR) von fintegra für Stiftungen zur Vereinfachung der Verwaltungsarbeit und Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, damit die Rendite ihres Stiftungsvermögens möglichst ungeschmälert dem Stiftungszweck zugutekommt.
Exkurs: Familienstiftungen in Liechtenstein –
Vermögensschutz, Nachfolgeplanung und Steueroptimierung
Eine Familienstiftung in Liechtenstein ist eine praxisbewährte Option zur Strukturierung des Vermögens. Sie kann insbesondere dem generationenübergreifenden Vermögensschutz dienen, als Instrument der Vermögensnachfolge eingesetzt werden oder als Dachstruktur bei unternehmerischen Aktivitäten helfen. Sie profitiert zudem von einem attraktiven Besteuerungssystem.
Die Familienstiftung in Liechtenstein hat diverse Vorzüge in der Strukturierung des Vermögens. Die Vorteile resultieren aus den generellen Prinzipien der Stiftung als verselbstständigtes Zweckvermögen, der politischen wirtschaftlichen Stabilität des Fürstentums sowie dem modernen und flexiblen Stiftungsrecht. Ergänzend hat Liechtenstein ein attraktives Steuersystem zur Besteuerung der Erträge. Eine Erbschaftsteuer oder eine Erbersatzsteuer für Familienstiftungen gibt es nicht.
Das Fürstentum ist eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage (Artikel 2 der Landesverfassung). Die Regierung ist sowohl dem Landtag als auch dem Fürsten verantwortlich. Der Fürst ernennt auf Vorschlag des Parlaments die Regierung und hat ein Veto-Recht gegen jedes Gesetz.
Der Staat ist nicht verschuldet und hat als eine der wenigen Staaten weltweit ein AAA-Rating von Standard & Poors Global. Grundlage der positiven Bewertung sind insbesondere die solide Haushaltspolitik und der damit verbundene staatliche Handlungsspielraum, sowie die sehr niedrige Arbeitslosenquote (1,3 % im Jahr 2022). Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist eines der höchsten weltweit. Gesetzliches Zahlungsmittel der Schweizer Franken.
Liechtenstein ist kein EU-Mitglied, jedoch Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Die Grundfreiheiten der Kapitalverkehrsfreiheit, Niederlassungsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit, und Warenverkehrsfreiheit sind damit garantiert. Mit der benachbarten Schweiz besteht eine Zollunion.
Die Fürstenfamilie steht für ein liberales Staatsverständnis. Die Staatsquote beträgt lediglich ca. 20 % im Vergleich zur deutschen Staatsquote von ca. 50 %. Auch das Stiftungsrecht basiert auf einem liberalen Ansatz. Das Stiftungsrecht wurde im Jahr 2009 umfassend neu geregelt. Es ist Bestandteil des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) und gilt weltweit als modern sowie flexibel. Liechtenstein ist damit aus guten Gründen weltweit als Stiftungsstandort sehr gefragt. Derzeit gibt es ca. 10.000 privatnützige Stiftungen. Darunter befinden sich zahlreiche Unternehmensträgerstiftungen zur generationenübergreifenden Unternehmensfortführung.
Die Einsatzmöglichkeiten einer Familienstiftung in Liechtenstein sind insbesondere
- Gestaltung eines umfassenden Vermögensschutzes („asset protection“; „wealth preservation“),
- Gestaltung von Holding-Strukturen für bestehende oder künftige geschäftliche Aktivitäten. Die Unternehmensstiftung ist in Liechtenstein ausdrücklich gesetzlich vorgesehen.
- Unterstützung begünstigter Familienmitglieder insbesondere in der Ausbildung, der wirtschaftlichen Existenzgründung, Unterhalt sowie Alters- und Krankenvorsorge,
- Nachfolgeplanung.
Ergänzend zu diesen privatnützigen, unternehmerischen Zwecken sind auch gemeinnützige Stiftungszwecke möglich. Alternativ als ausschließliche gemeinnützige Stiftung oder als gemischte Stiftung.
Die erste Weichenstellung in der steuerlichen Beurteilung ist die Gestaltung der Unwiderruflichkeit oder Widerruflichkeit.
Wenn sich der Stifter keinen Widerruf vorbehält, wird die Stiftung in Liechtenstein steuerlich als intransparent behandelt. Das Vermögen und die Erträge werden der Stiftung zugerechnet. Es entsteht eine steuerliche Abschirmwirkung gegenüber dem Stifter und den Begünstigten der Stiftung. Dies entspricht der Systematik einer deutschen Stiftung. Die Stiftung in Liechtenstein ist ein eigenständiges Steuersubjekt.
Versteuerung des Reinertrags mit 12,5 %
Die zweite Weichenstellung besteht darin, ob die Stiftung ausschließlich gemeinnützige Zwecke hat.
Unwiderrufliche Stiftungen, die keinen gemeinnützigen Zweck haben, werden grundsätzlich gemäß Artikel 44 Steuergesetz Liechtenstein („SteG“) besteuert. Hiernach wird der Reinertrag der Stiftung mit 12,5 % versteuert.
Grundlage für die Besteuerung ist die Erfolgsrechnung der Stiftung. Der Saldo der Erfolgsrechnung wird um steuerliche Zuschläge und Abschläge verändert (Artikel 47 Absatz 3 SteG). Im Grundsatz entspricht dieser Mechanismus der deutschen Systematik, in der das Steuerrecht an den handelsrechtlichen Jahresabschluss anknüpft. Die Bewertung der Vermögenswerte erfolgt grundsätzlich mit dem Verkehrswert.
Ein steuerlicher Abschlag erfolgt in Höhe von 4 % des Eigenkapitals (sog. Eigenkapitalzinsabzug).
Die Stiftung muss nicht zwingend eine Buchhaltung nach dem Personen- und Gesellschaftsrecht (Artikel 1045 ff PGR) führen. In den Statuten der Stiftung kann dies ausgeschlossen werden. Dann reichen nachvollziehbare Aufstellungen über die Aktiva und Passiva sowie die Erträge und die Aufwendungen aus.
Zuwendungen an die Begünstigten mindern den Gewinn der Stiftung nicht. Auch dies entspricht der steuerlichen Beurteilung bei einer deutschen Familienstiftung. Zuwendungen an die Begünstigten der Stiftung sind steuerlich als Gewinnverwendung einzuordnen.
Steuerbefreiungen
Wirtschaftlich von großer Bedeutung sind die Steuerbefreiungen nach dem Liechtensteiner Steuerrecht (Artikel 48 SteG). Steuerfrei sind insbesondere:
- Dividenden aus in- und ausländischen Beteiligungen.
Kapitalgewinne aus der Veräußerung oder Liquidation in- und ausländischer Beteiligungen.
Hieraus ergeben sich langfristig erhebliche wirtschaftlich Effekte. Dies insbesondere dann, wenn die Erträge in der Stiftung weiter angelegt werden. Auf diese Weise kann ein signifikantes Vermögen hinter der „Brandmauer“ der Stiftung erwirtschaftet werden, das nach den Regelungen der Statuten und Beistatuten anlassbezogen den Begünstigten der Stiftung zufließen kann.
Private Vermögensstruktur (PVS)
Eine Ausnahme von der regulären Besteuerung des Reinertrags mit 12,5 % ist die private Vermögensstruktur („PVS-Struktur“), die in Artikel 64 SteG geregelt ist.
Stiftungen, die nicht wirtschaftlich tätig sind und die auf die eigene Vermögensverwaltung beschränkt sind, können als PVS-Struktur ausgestaltet werden. Gegenstand der Vermögensverwaltung der Stiftung sind in diesem Fall insbesondere Finanzanlagen und liquide Mittel. Ein aktives, gewerbliches Handeln (trading) kann nicht als PVS-Struktur ausgestaltet werden.
Die Vermietung von Immobilien ist bei der Ausgestaltung als PVS-Struktur nicht möglich. Ebenfalls unzulässig ist die Gewährung von verzinslichen Darlehen. Beteiligungen sind nur dann zulässig, wenn die PVS-Struktur keinen unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss auf die Beteiligungsgesellschaften ausübt.
PVS-Strukturen bezahlen ausschließlich die Mindeststeuer von CHF 1.800 pro Jahr. Sie sind zudem nicht verpflichtet, eine Steuererklärung zu erstellen. Neben der günstigen Besteuerung ist damit auch der erheblich reduzierte Verwaltungsaufwand ein Vorteil der PVS-Struktur.
Die Statuten der Stiftung müssen klarstellen, dass die Stiftung als PVS ausgestaltet ist.
Handlungsempfehlung
Bei der Ausgestaltung als PVS-Struktur müssen auch die Wirkungen für die deutsche Besteuerung betrachtet werden. Für das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Liechtenstein gilt eine PVS-Struktur nicht als ansässig. Eine PVS-Struktur kann sich damit nicht auf den Schutz des Doppelbesteuerungsabkommens berufen. Zudem müssen die Wirkungen einer PVS-Struktur für das deutsche Außensteuerrecht geprüft werden.
Das Vermögen einer widerruflichen Stiftung wird weiterhin dem Stifter zugerechnet. Die Stiftung zahlt in diesem Fall keine Steuern auf die Erträge. Die Stiftung zahlt lediglich die Mindeststeuer von CHF 1.800 pro Jahr.
Gemeinnützige Stiftungen
Gemeinnützige Stiftungen sind in Liechtenstein von allen Landessteuern befreit, wenn Sie ausschließlich und unwiderruflich gemeinnützige Zwecke verfolgen (Artikel 4 Absatz 2 SteG). Auch die Mindestertragsteuer entfällt in diesem Fall.
Die zulässige gemeinnützige Tätigkeit ist weitergehend als der Katalog der gemeinnützigen Zwecke nach deutscher Beurteilung. Es reicht aus, wenn nur ein bestimmter Personenkreis gefördert wird. Die gemeinnützige Tätigkeit kann auch international erfolgen.
Eine gemischt gemeinnützige Stiftung ist stiftungsrechtlich möglich, aber nicht steuerbefreit. Die Steuerbefreiung setzt eine ausschließliche gemeinnützige Tätigkeit voraus.
Die Voraussetzungen werden jährlich von der Steuerverwaltung in Liechtenstein geprüft.
Erbschaftsteuerfreiheit
Das Vermögen einer Stiftung in Liechtenstein ist erbschaftsteuerfrei. Das gilt für das unmittelbare Stiftungsvermögen, z.B. Kapitalanlagen, die von einem Vermögensverwalter für die Stiftung verwaltet werden. Erbschaftsteuerfrei sind auch Immobilien in Deutschland oder stiftungsverbundene Unternehmen, unabhängig von der Rechtsform und der Beteiligungshöhe.
Anders als eine deutsche Familienstiftung zahlt eine Familienstiftung in Liechtenstein keine Erbersatzsteuer.
Schritte zur Gründung einer Familienstiftung in Liechtenstein
Eine Stiftung kann zunächst von jeder natürlichen Person errichtet werden. Daneben können auch juristische Personen Stiftungen in Liechtenstein errichten, z.B. Unternehmen, die als Kapital- oder Personengesellschaft organisiert sind.
Eine Stiftung kann zu Lebzeiten von einer oder mehreren natürlichen oder juristischen Personen errichtet werden. Eine durch Testament oder Erbvertrag errichtete Stiftung kann nur einen Stifter haben.
Ein nicht geschäftsfähiger Stifter kann bei der Errichtung durch seinen gesetzlichen Vertreter vertreten werden.
Anders als im deutschen Stiftungsrecht ist das Mindestkapital einer Stiftung in Liechtenstein gesetzlich klar geregelt. Um eine Stiftung in Liechtenstein errichten zu können, ist mindestens ein Kapital von 30.000 erforderlich, das als Barvermögen in CHF / EUR / US-Dollar erbracht werden kann. Alternativ ist eine Errichtung der Stiftung mit Sachverwerten möglich.
In der Praxis wird die Stiftung häufig durch ein Treuhandunternehmen als indirekter Stellvertreter des Stifters errichtet (sog. Treuhandgründung). Der Vertretene wird in diesem Zusammenhang als „wirtschaftlicher Stifter“ bezeichnet. Die mit der Stifterstellung verbundenen Rechte stehen in diesem Fall dem wirtschaftlichen Stifter zu.
Die Errichtung der Stiftung erfolgt durch eine schriftliche Stiftungserklärung. Die Unterschrift des Stifters oder des Stellvertreters muss beglaubigt werden.
Die Stiftungsdokumentation besteht aus der Stiftungsurkunde (synonym: Statut), der Stiftungszusatzurkunde (synonym: Beistatut) und etwaigen Reglementen.
Die Stiftungsurkunde muss mindestens die folgenden Bestandteile enthalten:
- Stifterwille zur Errichtung
- Name und Sitz der Stiftung
- Vermögenswidmung
- Stiftungszweck
- Datum der Errichtung
- Dauer der Stiftung
- Begünstigte
- Regelungen zur Organisation des Stiftungsmanagements (Stiftungsrat, Stiftungsaufsichtsrat) und zur Beschlussfassung
- Regelungen zur Auflösung
- Name, Vorname und Wohnsitz bzw. Firma und Sitz des Stifters.
In einem ergänzenden Beistatut kann die Art und Weise der Begünstigung in den Details geregelt werden. Reglemente sind in der Praxis insbesondere zur Ausgestaltung eines Kontrollorgans (sog. Protektor) üblich, sowie zu Einzelheiten der Vermögensverwaltung.
Anders als die Gründung einer Stiftung in Deutschland, die ein behördliches Anerkennungsverfahren voraussetzt, ist die Gründung einer Stiftung in Liechtenstein schnell und unkompliziert möglich. Ist die Stiftungsdokumentation ausgearbeitet, dauert die Gründung einer Stiftung in Liechtenstein i. d. R. nicht mehr als 14 Werktage.
In das Handelsregister muss eine Stiftung in Liechtenstein nur eingetragen werden, wenn sie ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt oder wenn es sich um eine gemeinnützige Stiftung handelt.
Familienstiftungen, die – wie im Regelfall – nicht gewerblich aktiv sind, müssen nicht eingetragen werden. Es wird lediglich die Stiftungsurkunde beim Amt für Justiz hinterlegt. Die Hinterlegung muss innerhalb von 30 Tagen nach Errichtung der Stiftung erfolgen. Ist nur eine Hinterlegung notwendig, entsteht die Familienstiftung mit Unterzeichnung der Errichtungsdokumente.
Fazit
Der Stiftungsstandort Liechtenstein ist wirtschaftlich sehr stabil und verfügt über ein modernes und flexibles Stiftungsrecht.
Die Ertragsbesteuerung einer Familienstiftung in Liechtenstein ist niedriger als bei einer deutschen Struktur.
Langfristig besteht der wesentliche steuerliche Vorteil darin, dass das Vermögen einer Stiftung in Liechtenstein außerhalb der Erbschaftsteuer entwickelt werden kann.
Eine Familienstiftung in Liechtenstein ist daher eine sehr interessante Option zur langfristigen Strukturierung des Vermögens mit wesentlichen steuerlichen Vorteilen.
Stand: September 2023